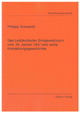Reviews
Reviews
Philipp Schwartz
Review
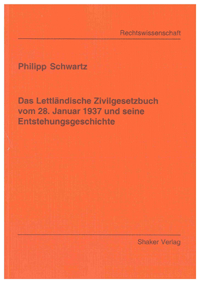
Philipp Schwartz
Review
Simon Burger
Die horizontale und vertikale Zuordnung der Umsetzungspflichten einschließlich der Haftung
Review
Die in Köln entstandene Dissertation behandelt ein für den Bundesstaat dauerhaft relevantes Thema, nämlich die Frage nach der Verantwortung bzw. Verantwortlichkeit bei der Umsetzung des Gemeinschaftsrechts. Im ersten Abschnitt erörtert Verf. die mitgliedstaatlichen...
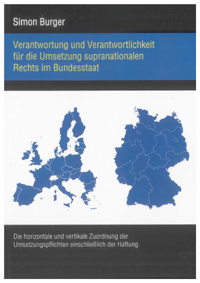
Simon Burger
Die horizontale und vertikale Zuordnung der Umsetzungspflichten einschließlich der Haftung
Review
Die in Köln entstandene Dissertation behandelt ein für den Bundesstaat dauerhaft relevantes Thema, nämlich die Frage nach der Verantwortung bzw. Verantwortlichkeit bei der Umsetzung des Gemeinschaftsrechts. Im ersten Abschnitt erörtert Verf. die mitgliedstaatlichen...
Jürgen Samtleben
Beiträge aus internationaler und regionaler Perspektive
Review
"Rezensieren heißt mustern". So fasste kürzlich eine große Tageszeitung (Magnus Klaue, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 18.5.2011, S. N5) den Doppelsinn des Begriffs zusammen: Ein Werk zu mustern, meine beides, es zu betrachten und es zu beurteilen,...
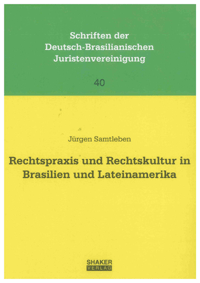
Jürgen Samtleben
Beiträge aus internationaler und regionaler Perspektive
Review
"Rezensieren heißt mustern". So fasste kürzlich eine große Tageszeitung (Magnus Klaue, Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 18.5.2011, S. N5) den Doppelsinn des Begriffs zusammen: Ein Werk zu mustern, meine beides, es zu betrachten und es zu beurteilen,...
Sebastian Berg
Review
Die Arbeit ist die von Peter Oestmann betreute, von der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Münster angenommene Dissertation des Verfassers. Sie dürfte es nach der Einleitung des Verfassers eigentlich nicht geben, weil nach der einheitlichen...
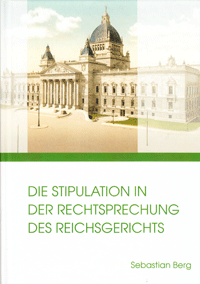
Sebastian Berg
Review
Die Arbeit ist die von Peter Oestmann betreute, von der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Münster angenommene Dissertation des Verfassers. Sie dürfte es nach der Einleitung des Verfassers eigentlich nicht geben, weil nach der einheitlichen...
|
|
Am Langen Graben 15a
52353 Düren
Germany
Fri. 8:00 a.m. to 3:00 p.m.