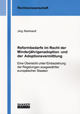Reviews
Reviews
Sven Joachim Keuter
Review
Vor nunmehr fast zehn Jahren hatte der BGH in seinem "Kolping"-Urteil (BGHZ 175, 12 ff.) über die persönliche Haftung von Mitgliedern eines entgegen § 21 BGB wirtschaftlich tätigen Vereins entschieden. Diese Entscheidung nimmt der...
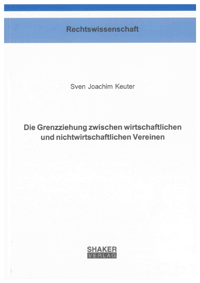
Sven Joachim Keuter
Review
Vor nunmehr fast zehn Jahren hatte der BGH in seinem "Kolping"-Urteil (BGHZ 175, 12 ff.) über die persönliche Haftung von Mitgliedern eines entgegen § 21 BGB wirtschaftlich tätigen Vereins entschieden. Diese Entscheidung nimmt der...
Bettina Kudlich
– Ausbildung und Forschung an der Juristischen Fakultät Erlangen im Dritten Reich –
Review
Die Forschungen zur Universitätsgeschichte haben seit den 1970er-Jahren verstärkt die Rolle der Universitäten im Nationalsozialismus ins Blickfeld genommen, teils in Form von Überblickskapiteln im Rahmen umfassender Darstellungen der Universitätsgeschichte,...
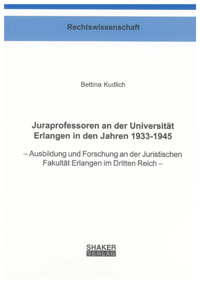
Bettina Kudlich
– Ausbildung und Forschung an der Juristischen Fakultät Erlangen im Dritten Reich –
Review
Die Forschungen zur Universitätsgeschichte haben seit den 1970er-Jahren verstärkt die Rolle der Universitäten im Nationalsozialismus ins Blickfeld genommen, teils in Form von Überblickskapiteln im Rahmen umfassender Darstellungen der Universitätsgeschichte,...
Jörg Reinhardt
Eine Übersicht unter Einbeziehung der Regelungen ausgewählter europäischer Staaten
Review
Die gesellschaftliche Sicht auf die Adoption von Minderjährigen aus dem ln- wie aus dem Ausland hat sich in den vergangenen Jahrzehnten erheblich verändert. Das wirkt sich nicht nur auf die Zahl der ausgesprochenen Adoptionen aus, sondern auch auf...
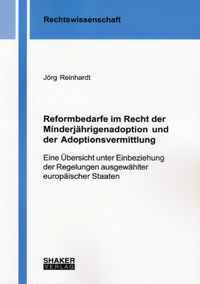
Jörg Reinhardt
Eine Übersicht unter Einbeziehung der Regelungen ausgewählter europäischer Staaten
Review
Die gesellschaftliche Sicht auf die Adoption von Minderjährigen aus dem ln- wie aus dem Ausland hat sich in den vergangenen Jahrzehnten erheblich verändert. Das wirkt sich nicht nur auf die Zahl der ausgesprochenen Adoptionen aus, sondern auch auf...
|
|
Am Langen Graben 15a
52353 Düren
Germany
Fri. 8:00 a.m. to 3:00 p.m.