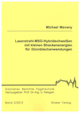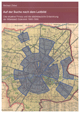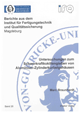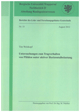Reviews
Reviews
Michael Mavany
Review
Die immer knapper werdenden Ressourcen und weiter steigenden Energiekosten erfordern neue Konzepte zum Leichtbau von Fahrzeugen. Hierzu zählt das Verbauen von dünneren, festeren Blechen. Eine Fügetechnik, die Einzug in den Fahrzeugbau gefunden hat,...
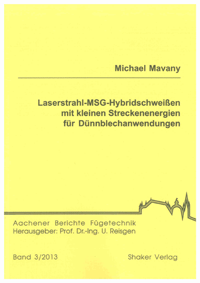
Michael Mavany
Review
Die immer knapper werdenden Ressourcen und weiter steigenden Energiekosten erfordern neue Konzepte zum Leichtbau von Fahrzeugen. Hierzu zählt das Verbauen von dünneren, festeren Blechen. Eine Fügetechnik, die Einzug in den Fahrzeugbau gefunden hat,...
Michael Zirbel
Das situative Prinzip und die städtebauliche Entwicklung der Mittelstadt Gütersloh 1945-1969
Book review
Die Arbeit geht der Frage nach, ob die Mittelstadt Gütersloh im Rahmen ihrer städtebaulichen Entwicklung einem Leitbild folgte. Da ein Leitbild nicht zu erkennen ist, wird die Frage erweitert um die Suche nach anderen Prinzipien, die der Stadtentwicklung...
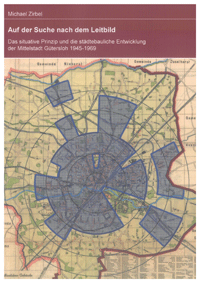
Michael Zirbel
Das situative Prinzip und die städtebauliche Entwicklung der Mittelstadt Gütersloh 1945-1969
Book review
Die Arbeit geht der Frage nach, ob die Mittelstadt Gütersloh im Rahmen ihrer städtebaulichen Entwicklung einem Leitbild folgte. Da ein Leitbild nicht zu erkennen ist, wird die Frage erweitert um die Suche nach anderen Prinzipien, die der Stadtentwicklung...
Frank Gerrit Poggenpohl
Book review
Die Reduktion von Brandrisiken stellt eine der wesentlichen Aufgaben von Werkfeuerwehren dar. Hierbei finden Brandschutzkonzepte Anwendung, die sowohl auf baulichen, anlagentechnischen als auch abwehrenden Brandschutzmaßnahmen basieren. Das zentrale...

Frank Gerrit Poggenpohl
Book review
Die Reduktion von Brandrisiken stellt eine der wesentlichen Aufgaben von Werkfeuerwehren dar. Hierbei finden Brandschutzkonzepte Anwendung, die sowohl auf baulichen, anlagentechnischen als auch abwehrenden Brandschutzmaßnahmen basieren. Das zentrale...
Ulrike Hecht
Review
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem gekoppelten eutektischen Wachstum der zwei festen Phasen AI und AI2Cu in monovariant erstarrenden AI-Cu-Ag-Legierungen. Im Bridgman-Stockbarger Verfahren wurden daraus polykristalline Proben...

Ulrike Hecht
Review
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem gekoppelten eutektischen Wachstum der zwei festen Phasen AI und AI2Cu in monovariant erstarrenden AI-Cu-Ag-Legierungen. Im Bridgman-Stockbarger Verfahren wurden daraus polykristalline Proben...
Marc Braunhardt
Review
Die Arbeit beschreibt - vor dem Hintergrund einer gewichtsoptimierten, aber dennoch kostengünstigen Fertigung - die Entstehung eines neu entwickelten, hoch belasteten Leichtbau-Zylinderkurbelgehäuses von der konstruktiven Gestaltung über die Simulation,...
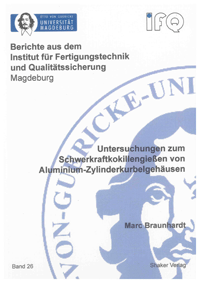
Marc Braunhardt
Review
Die Arbeit beschreibt - vor dem Hintergrund einer gewichtsoptimierten, aber dennoch kostengünstigen Fertigung - die Entstehung eines neu entwickelten, hoch belasteten Leichtbau-Zylinderkurbelgehäuses von der konstruktiven Gestaltung über die Simulation,...
Marcel Philipp Mayer
Wir gratulieren unserem Autor Herrn Marcel Ph. Mayer zum Erhalt des Walter-Rohmert-Preises 2013. Für seine Dissertation "Entwicklung eines kognitionsergonomischen Konzeptes und eines Simulationssystems für die robotergestützte Montage" wurde ihm am 28....
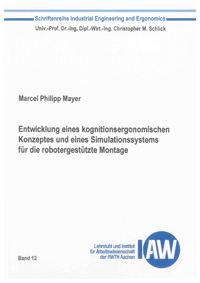
Marcel Philipp Mayer
Wir gratulieren unserem Autor Herrn Marcel Ph. Mayer zum Erhalt des Walter-Rohmert-Preises 2013. Für seine Dissertation "Entwicklung eines kognitionsergonomischen Konzeptes und eines Simulationssystems für die robotergestützte Montage" wurde ihm am 28....
Klaus Röbenack
Detektorempfänger und Audionschaltungen
Review
Elektronenröhren üben bis zum heutigen Tag eine gewisse Faszination auf Technikinteressierte aus. Das liegt bestimmt nicht nur daran, dass Röhrenschaltungen oft übersichtlicher und leichter verständlich sind als moderne Halbleiterapplikationen. Bastler...
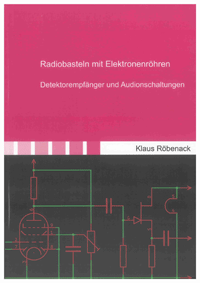
Klaus Röbenack
Detektorempfänger und Audionschaltungen
Review
Elektronenröhren üben bis zum heutigen Tag eine gewisse Faszination auf Technikinteressierte aus. Das liegt bestimmt nicht nur daran, dass Röhrenschaltungen oft übersichtlicher und leichter verständlich sind als moderne Halbleiterapplikationen. Bastler...
Robert Jüpner, Uwe Müller (Hrsg.)
News
Mitte Juni fand in Leipzig das "4. Forum zur Europäischen Hochwasserrisikomanagement- Richtlinie" statt. Die Experten der verschiedensten Fachrichtungen diskutierten die Umsetzung der Hochwasserrisikomanagement- Richtlinie in den Flussgebieten Elbe und...
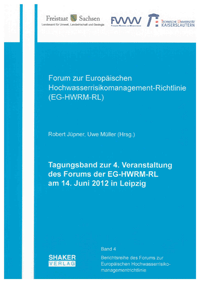
Robert Jüpner, Uwe Müller (Hrsg.)
News
Mitte Juni fand in Leipzig das "4. Forum zur Europäischen Hochwasserrisikomanagement- Richtlinie" statt. Die Experten der verschiedensten Fachrichtungen diskutierten die Umsetzung der Hochwasserrisikomanagement- Richtlinie in den Flussgebieten Elbe und...
Tim Welskopf
Book review
Vertikale Pfähle tragen horizontale Belastungen am Pfahlkopf im umgebenden Boden durch horizontale Bettungsspannungen ab. ln diesem Prozess wird der mobilisierbare Pfahlwiderstand durch die Pfahl-Boden-Interaktion bestimmt. Trotz zahlreicher Untersuchungen...
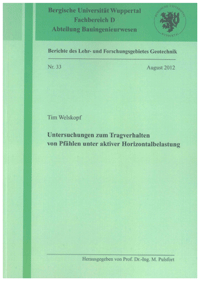
Tim Welskopf
Book review
Vertikale Pfähle tragen horizontale Belastungen am Pfahlkopf im umgebenden Boden durch horizontale Bettungsspannungen ab. ln diesem Prozess wird der mobilisierbare Pfahlwiderstand durch die Pfahl-Boden-Interaktion bestimmt. Trotz zahlreicher Untersuchungen...
Jochen Vennekötter
Book review
lnfolge einer zunehmenden Urbanisierung werden unterirdische Infrastrukturnetze in dicht besiedelten Gebieten weiter ausgebaut und erneuert. Dies führt zu einer steigenden Nachfrage nach Verfahrenstechniken des grabenlosen Leitungsbaus. Als Alternative...
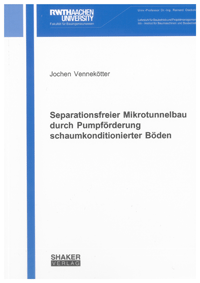
Jochen Vennekötter
Book review
lnfolge einer zunehmenden Urbanisierung werden unterirdische Infrastrukturnetze in dicht besiedelten Gebieten weiter ausgebaut und erneuert. Dies führt zu einer steigenden Nachfrage nach Verfahrenstechniken des grabenlosen Leitungsbaus. Als Alternative...
|
|
Am Langen Graben 15a
52353 Düren
Germany
Fri. 8:00 a.m. to 3:00 p.m.