
Reviews
Reviews
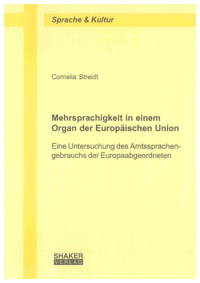
Cornelia Streidt
Mehrsprachigkeit in einem Organ der Europäischen Union
Eine Untersuchung des Amtssprachengebrauchs der Europaabgeordneten
Review
In seiner 1996 erschienenen Monografie über die Amtssprachen in den Organen der Europäischen Union blickt der Autor, Michael Schloßmacher, pessimistisch auf die Zukunft des Sprachenregimes der Union, das mit jeder hinzukommenden Amtssprache schwerfälliger und unpraktikabler wird und zudem die Kosten für Übersetzungen und Dolmetschertätigkeiten unzulässig steigen lässt.(1)
Gut 15 Jahre später, in einer EU-27 mit 23 offiziellen Amts- und Arbeitssprachen, prüft Cornelia Streidt in ihrer an der Technischen Universität Dresden vorgelegten Dissertation anhand der Abgeordneten des Europäischen Parlaments, ob diese Vorhersage Schloßmachers sich bewahrheitet hat.
(1) Schloßmacher, Michael, Die Amtssprachen in den Organen der Europäischen Gemeinschaft: Status und Funktion, Frankfurt am Main: Lang, 1996, 161.
Die Autorin will dabei, wie Schloßmacher zuvor, empirisch belastbare Daten mittels einer schriftlichen Befragung der Abgeordneten sowie einiger Interviews liefern, um aufzuzeigen, in welchen Situationen welche Arbeits- und Amtssprachen verwendet werden. Zusätzlich liegt ein besonderer Fokus auf der Betrachtung des Englischen, Französischen und Deutschen, wobei hier vor allem die Zu- oder Abnahme der Verwendung seit der Untersuchung Schloßmachers zu Beginn der Neunzigerjahre dargestellt wird. Sie diskutiert Reformen des Sprachenregimes, wobei auch hier mittels Befragungen die Meinung der Europaabgeordneten analysiert und interpretiert wird.
Für den diachronischen Vergleich steht Streidt neben den Ergebnissen Schloßmachers aus der dritten Wahlperiode (1989-1994) und ihrer Untersuchung aus der sechsten Wahlperiode (2004-2009) zusätzlich eine von ihr durchgeführte Befragung aus der fünften Wahlperiode (1999-2004) zur Verfügung, die vor der Aufnahme der zehn mittel- und osteuropäischen Staaten plus Zypern und Malta sowie Rumänien und Bulgarien erhoben wurde. Eben jene letzte(n) Erweiterungsrunde(n) rechtfertigt/en eine solche empirische Studie, da das vorliegende Datenmaterial veraltet ist. Tatsächlich liegen wenige soziolinguistische Arbeiten vor, die sich auf neuere empirische Daten berufen können. Mit dem Thema beschäftigten sich vor allem Wissenschaftler mit einem anderen theoretischen Hintergrund wie Translationswissenschaften oder interkulturelle Forschung. Die hierangewandte Methode stellt selbstverständlich nur eine tendenzielle Abbildung des Sprachgebrauchs dar. Angesichts der Komplexität der untersuchten Materie ist aber ein Fragebogen mit Selbsteinschätzung durchaus gerechtfertigt, zumal sich die Autorin bewusst ist, dass individuelle Sprachkenntnisse, nationale und politische Einstellungen der Befragten die Beantwortung beeinflussen können. Um die Vergleichbarkeit zu garantieren, greift die Autorin auf Schloßmachers Fragebogen zurück, auf dem die Abgeordneten eine der Amtssprachen als die ihre kennzeichnen und dann entsprechend verschiedenen Kommunikationssituationen mittels eines prozentualen Wertes angeben, wie oft sie welche Sprache verwenden. Außerdem wird nach Verfügbarkeit und Zufriedenheit mit Übersetzungen und Dolmetschertätigkeiten gefragt und es werden zwei abschließende Fragen zur Reform des Sprachenregimes gestellt.
Die ersten beiden Kapitel (Kapitel 2 und 3) sind dem institutionellen Aufbau der Europäischen Union sowie dessen Sprachenregime gewidmet, wobei jeweils der Fokus auf dem Europäischen Parlament liegt. Die Beschreibung in Kapitel 2 liefert einen guten, aber ausreichend kurzen Einstieg in die Thematik für ein nicht mit der EU vertrautes Publikum. In Kapitel 3 werden grundlegende Begriffe wie Arbeits- und Amtssprache in Verbindung mit der Geschichte der Sprachpolitik der europäischen Institutionen vorgestellt, um anschließend genauer auf die aktuelle Situation im Parlament einzugehen. Mittels der Vorstellung des Verhaltenskodex Mehrsprachigkeit, den sich die Abgeordneten selbst gegeben haben, kommen sowohl die unterschiedlichen offiziellen (Plenum, Ausschuss, Fraktion, Arbeitsgruppe, Delegation) sowie inoffiziellen Kommunikationssituationen (Pausen, Essen o. ä.) als auch bereits die aktuellen Probleme beim Dolmetschen und Übersetzen zur Sprache (54f.). Streidt lässt es sich dabei nicht nehmen, gängige Klischees über die EU zu widerlegen, indem sie z.B. die Gesamtkosten für den angeblich zu teuren Sprachendienst der EU auf lediglich 2,30 Euro pro Unionsbürger pro Jahr beziffert (62) oder den arbeitsreichen Alltag der Buropaabgeordneten erwähnt (91). Dieses Kapitel zeigt ebenfalls die juristische Gleichrangigkeit der Termini Amts- und Arbeitssprache auf, die Streidt um Schloßmachers Definition von vertraglich festgelegten und faktischen Arbeitssprachen ergänzt (46).
Beginnend mit Kapitel 4, in dem die Sprachkenntnisse der Abgeordneten thematisiert sowie die Generaldirektionen Dolmetschen und Übersetzen vorgestellt werden, lassen sich erste Tendenzen für die Beantwortung einer von Streidts Fragen erkennen: Die Verwendung des Französischen ist seit der dritten Wahlperiode nachhaltig zurückgegangen. Dafür spricht die Tatsache, dass zwar inzwischen viele Abgeordnete mehr als eine Fremdsprache beherrschen, dafür aber immer weniger Parlamentarier Kenntnisse des Französischen besitzen (68). Neben den zu erwartenden Englischkenntnissen sind hier noch Russischkenntnisse einiger Mittel- und Osteuropäer interessant, die möglicherweise zur Kommunikation in informellen Situationen dienen (69). Leider führt die Autorin diese Überlegungen im folgenden Teil nicht aus, da sie sich allein auf die offiziellen Amts- und Arbeitssprachen der Union beschränkt.
Die nachfolgende Untersuchung über den mündlichen und schriftlichen Sprachgebrauch der Europaabgeordneten wird jeweils gesamt und noch einmal unterteilt in Kontakte mit den Generaldirektionen des Parlaments und jene mit der Kommission sowie informelle Situationen ausgewertet. Dabei geht die Autorin bei jedem Punkt gesondert auf die Nicht-Amtssprachensprecher ein und liefert sehr umfangreiche Tabellen, um den Vergleich zwischen den drei vorliegenden Erhebungen ziehen zu können. Etwas unglücklich wirkt hier die Darstellung der Zahlen aus der fünften Wahlperiode, da diese ausweislich statistisch kaum belastbar sind (96). So war die Rücklaufquote für den verschickten Fragebogen 2000 zwar höher als noch bei Schloßmachers Untersuchung aus dem Jahr 1991 (2000: 27% gegenüber 1991: 21 %). Allerdings sind einige Nationen dabei stark unterrepräsentiert, z.B. Spanien mit einer Rücklaufquote von 6%, das Vereinigte Königreich mit 10% und Italien mit 12%. Dagegen führen Deutschland mit 47%, Österreich mit 52% und die Niederlande mit 54% Rücklaufquote zu einer unverhältnismäßigen Betonung der Amtssprache Deutsch, was sich in den dargestellten Ergebnissen widerspiegelt. Die Befragung von 2007 dagegen ist mit einer Rücklaufquote von 34% und Antworten aus allen 27 Mitgliedstaaten erfolgreicher verlaufen. Die überzeugend dargelegten Ergebnisse bestätigen den Eindruck aus Kapitel 4. Das Englische dominiert die mündliche Kommunikation im Parlament. Besonders in der Kommunikation mit den Generaldirektionen des EP und mit der Kommission hat sich diese Sprache inzwischen eindeutig gegenüber dem Französischen durchgesetzt (116). Der ermittelte Wert des Letzteren sinkt um mehr als die Hälfte in allen Kommunikationssituationen gegenüber dem Wert von 1991 (117). Bei der Darstellung aller Befragten in der gesamten mündlichen Kommunikation muss es dem Deutschen den 2. Platz überlassen; dessen Erhöhung ist vor allem auf den häufigeren Gebrauch von Sprechern, deren Amtssprache nicht Deutsch ist, zurückzuführen (ebd.). Das gleiche Bild ergibt sich bei der schriftlichen Kommunikation. Auch hier dominiert das Englische, das Deutsche verbessert sich leicht, der Gebrauch der französischen Sprache dagegen hat in beinahe allen Kommunikationssituationen massiv abgenommen (140f.).
Die letzten beiden Punkte des Kapitels 6 widmet Streidt der Evaluation des Dolmetsch- und des Übersetzungsdienstes, die von den Abgeordneten bewertet wurden. Hierbei werden neben der Verfügbarkeit der entsprechenden Dienste in den oben genannten offiziellen Kommunikationssituationen auch die Zufriedenheit der Abgeordneten erhoben und diese Werte mit jenen der 3. und 5. Wahlperiode verglichen. Insgesamt zeichnet sich ein ähnliches Ergebnis wie in den Kapiteln zuvor ab. Dem Englischen kommt aufgrund ständig bereitstehender Verdolmetschung und übersetzter Dokumente der Status einer de-facto-Arbeitssprache zu. Mit gewissem Abstand können das für den Dolmetschdienst auch das Französische, Deutsche und Spanische von sich behaupten (177). Trotz der Anerkennung für die Dienste zeigen sich aber durch Streidts Ergebnisse auch einige Verschlechterungen, so z. B. bei der Bereitstellung von Dolmetschern und übersetzten Dokumenten in den Ausschüssen, bei Arbeitsgruppentreffen und bei der Delegationstätigkeit (176, 214). Selbst im Plenum treten, wenn auch selten, Probleme durch nicht übersetzte Dokumente auf. Da die Autorin mehrfach anspricht, dass dies auch zur Verweigerung von Abstimmungen führt (213), wäre an dieser Stelle eine breitere Diskussion über die Konsequenzen wünschenswert. Streidt belässt es hier zunächst bei der Wiedergabe der Aussagen der Abgeordneten und der Erwähnung, dass das Parlament seine Besorgnis über fehlende Dokumente in der Ausschussarbeit ausgedrückt hat (193). Da gerade in diesen Gremien die sensiblen juristischen Details von Gesetzesakten besprochen werden, ist es fraglich, ob das Fehlen von Verdolmetschung und Übersetzungen hier genauso unkommentiert bleiben sollte wie bei, vor allem guten Beziehungen dienenden, Delegationstreffen.
Das letzte Kapitel ist den Vorschlägen der Abgeordneten zur Reform des Sprachendienstes gewidmet. Hierbei hat sich gegenüber der Erhebung Schloßmachers wenig verändert. Knapp zwei Drittel der Abgeordneten sind für die Beibehaltung der aktuellen Sprachregelung (220). Entsprechend lehnt eine Mehrheit die Einführung offizieller Amtssprachen ab, wobei diese Ablehnung in den vergangenen Jahren noch zugenommen hat, vor allem bei Sprechern aus den alten Mitgliedsstaaten (222). Die wenigen vorgeschlagenen Alternativen beinhalten alle zumindest Englisch und Französisch, wahlweise mit Deutsch, Polnisch, Spanisch oder/und Italienisch (233). In einer kurzen Prognose stellt Streidt noch einmal entgegengesetzte Aussagen zur Zukunft des Französischen dar. Einige Abgeordnete rechnen mit einer weiteren Verringerung des Gebrauchs, andere glauben an den Erhalt des Status quo (237).
Mit Blick auf Streidts zentrale Fragestellung ist es ihr gelungen, aktuelle empirische Befunde über den Sprachgebrauch im Europäischen Parlament zu liefern, die dank des Fragebogens von Schloßmachers Arbeit Vergleiche und Tendenzen in der Entwicklung der Sprachen zeigen. Da ein besonderer Fokus auf den Amtssprachen Deutsch und Französisch lag, wäre eine ausführlichere Diskussion zu diesen beiden Sprachen bei gleichzeitiger Verkürzung allgemeiner Bemerkungen zur EU wünschenswert gewesen. Dies hätte zu umfangreicheren Erkenntnissen geführt, als es die reine Wiedergabe der Studienergebnisse erlaubt.
Berlin
Fabian Fischer
Am Langen Graben 15a
52353 Düren
Germany
Fri. 8:00 a.m. to 3:00 p.m.

