
Reviews
Reviews
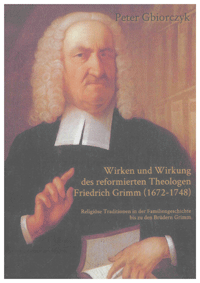
Peter Gbiorczyk
Wirken und Wirkung des reformierten Theologen Friedrich Grimm (1672-1748)
Religiöse Traditionen in der Familiengeschichte bis zu den Brüdern Grimm
Review
Über die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm ist schon viel geschrieben worden. Selbstverständlich blieben dabei auch ihre Familiengeschichte und religiöse Prägung nicht unbeachtet. Forscht man zu diesen beiden Themenbereichen, führen alle Wege schlussendlich zum Urgroßvater, Friedrich Grimm, der als Inspektor der reformierten Kirchen der Grafschaft Hanau wirkte und auf die Religiosität seiner Nachfahren deutlichen Einfluss hatte. Diesem für die Hanauische Geschichte bedeutenden Theologen widmete Peter Gbiorczyk, bis 2005 Dekan des Kirchenkreises Hanau-Land, mit dem vorliegenden Werk die erste umfassende Biographie. Dem Fachgebiet des Autors entsprechend und der untersuchten Person angemessen, beschäftigt sich der Hauptteil der Untersuchung mit dem Leben und der Theologie Friedrich Grimms; den im Untertitel genannten Traditionslinien in der Familiengeschichte der Grimms ist das letzte Viertel des Buches gewidmet. Lebensbeschreibung und Aufgaben Grimms in den verschiedenen Stationen seines Lebens werden detailliert anhand von Primärquellen dargelegt. Dabei wird immer wieder ausführlich aus den Quellen zitiert, zudem befindet sich im Anhang ein 133-seitiger Quellenteil, in dem die wichtigsten im Text behandelten Werke teils vollständig, teils in Auszügen abgedruckt wurden. Darunter befinden sich Schul- und Kirchenordnungen, Dekrete, Amtsanweisungen, theologische Thesen, Briefe, das Vorwort des 1719 von Grimm neu herausgegebenen Katechismus sowie zwei von Grimm gehaltene Leichenpredigten. Wünschenswert wäre hier eine konsequentere Standorts- und Signaturbezeichnung der Quellen gewesen, deren Herkunft bei einigen Stücken vorbildlich ausgewiesen wird, bei anderen aber nur im Standort besteht, bei manchen gar völlig fehlt.
Der Textteil bietet in seiner Ausführlichkeit einen aufschlussreichen Einblick in die theologische Landschaft des ausgehenden 17. und beginnenden 18. Jhs. in Hanau. Dabei werden nicht nur die Aufgaben eines reformierten Inspektors und Kirchenrates vor Augen gestellt, sondern es wird an etlichen Beispielen auch die außergewöhnliche Situation der gemischtkonfessionellen Grafschaft Hanau deutlich, die oftmals gesonderter Aufmerksamkeit der Kirchenoberen bedurfte. Der theologischen Ausrichtung Friedrich Grimms wird selbstverständlich ebenfalls ein durch Quellenzitate engmaschig gestütztes Kapitel gewidmet. Damit ergibt sich ein umfassendes Bild des Theologen Grimm, seiner Aufgaben als Inspektor und Kirchenrat und seiner familiären Situation bis zu seinem Tod 1748. Sein Nachleben wird sodann im letzten Abschnitt deutlich, in dem in kurzen biographischen Abrissen vor allem die religiöse Ausrichtung und das entsprechende Wirken seiner Nachkommen bis zu Jacob, Wilhelm und Ludwig Emil Grimm behandelt wird. Für den Leser wäre ein Schlusswort hilfreich gewesen, das leider völlig fehlt. So bleibt die Darstellung der religiösen Werte Ludwig Emil Grimms am Ende quasi im luftleeren Raum stehen, ohne dass noch einmal die „Hauptfigur“ der Untersuchung in den Blick kommt und ein Fazit gezogen wird.
Insgesamt bietet die Biographie einen aufschlussreichen und besonders durch die Quellennähe wertvollen Einblick in das Leben und Wirken eines reformierten Theologen an der Wende des 17. zum 18. Jh., der zudem durch den Bezug zu den Brüdern Grimm eine weitreichendere Relevanz bekommt.
Marburg
Birthe zur Nieden
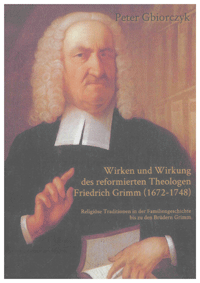
Peter Gbiorczyk
Wirken und Wirkung des reformierten Theologen Friedrich Grimm (1672-1748)
Religiöse Traditionen in der Familiengeschichte bis zu den Brüdern Grimm
Review
Peter Gbiorczyk, bis 2005 Dekan des Kirchenkreises Hanau-
Land, legt mit seinem 2013 erschienenen Werk die erste
ausführllche Biographie Friedrich Grimms vor. Der reformierte
Theologe und Urgroßvater Jacob und Wilhelm Grimms wirkte
in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts als Pfarrer,
Inspektor und Konsistorialrat in der gemischtkonfessionellen
Grafschaft Hanau und beeinflusste die Reilgiosität der Familie
Grimm nachhaltig. Grimms familiäre Herkunft und berufliche
Laufbahn werden in der Untersuchung ebenso beleuchtet wie
seine Theologie und damit verbunden seine Schriften sowie
das berufliche Wirken als Konsistortalrat und Inspektor, die in
einzelnen Kapiteln jewells ausführtich erläutert werden.
Der letzte Abschnitt des Buches ist der Familien- und
Wirkungsgeschichte der Grimms bis hin zur Urenkelgeneration
um Jacob, Wilhelm und Ludwig Emil Grimm gewidmet. In Form
von Kurzbiographien legt Gbiorczyk dar, wie Grimms
Nachkommen durch dle reformierte Frömmigkeit der Familie
in ihrer Lebensgestaltung und -Philosophie beeinflusst wurden.
Die Ausführungen geschehen dabei auf Basis zahlreicher
Quellen, die wichtigsten von ihnen finden sich in einem
ausführlichen, 133-seitigen Quellenteil am Ende des Werkes
vollständig oder in Auszügen abgedruckt. Dieser enthält unter anderem drei teilweise umfangreiche Leichenpredigten, die von Grimm in seiner Funktion als reformierter Pfarrer gehalten wurden und später im Druck
erschienen. Die Leichenpredigten, unter ihnen eine auf Philipp Reinhard Graf von Hanau-Münzenberg, werden von Gbiorczyk zudem in einem eigenen Abschnitt behandelt und dienen als zusätzliche Quelle für Grimms Ansichten zu Religion, Seelsorge und Herrschaft. Ergänzend wirken zudem zahlreiche Abbildungen.
Am Langen Graben 15a
52353 Düren
Germany
Fri. 8:00 a.m. to 3:00 p.m.

