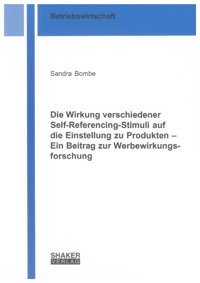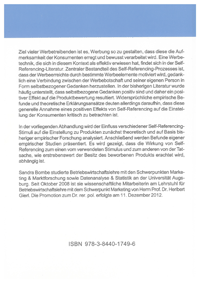Shop : Details
Shop
Details
49,80 €ISBN 978-3-8440-1749-6Softcover246 pages50 figures366 g21 x 14,8 cmGermanThesis
March 2013
Sandra Bombe
Die Wirkung verschiedener Self-Referencing-Stimuli auf die Einstellung zu Produkten – Ein Beitrag zur Werbewirkungsforschung
Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit war die Fragestellung, wie es Unternehmen und Werbetreibenden gelingt, Werbung so zu gestalten, dass diese die Aufmerksamkeit der Konsumenten erregt und bewusst verarbeitet wird. Eine Werbetechnik, die dieses Ziel verfolgt, findet sich in der Self-Referencing-Literatur. In der Self-Referencing-Literatur wird unterstellt, dass eine Werbung vom Konsumenten mehr Aufmerksamkeit erhält, wenn sich dieser persönlich angesprochen fühlt. Ist dies der Fall, stellt der Konsument mehr kognitive Ressourcen zur Verarbeitung der Werbung und/oder zur Bildung selbstbezogener Gedanken bereit. Je mehr kognitive Ressourcen zur Verarbeitung der Werbung bereitgestellt werden, desto mehr selbstbezogene Gedanken können generiert werden. Gedanken wie „ich kann mir vorstellen, wie ich selbst den beworbenen Pkw fahre“ oder „ich erinnere mich an eigene Probleme mit meinem PC“ sind Beispiele für selbstbezogene Gedanken. Ein zentraler Bestandteil des Self-Referencing-Prozesses ist somit, dass Konsumenten eine Verbindung zwischen der Werbung und der eigenen Person in Form selbstbezogener Gedanken herstellen. In der Literatur wird häufig unterstellt, dass selbstbezogene Gedanken positiv sind und daher ein positiver Effekt auf die Produktbewertung resultiert. Allerdings deuten einige Befunde in der bisherigen Forschung daraufhin, dass die generelle Annahme eines positiven Effekts von Self- Referencing auf die Einstellung der Konsumenten kritisch zu sehen ist. Zudem lieferten Autoren, die sich tiefer mit den zugrunde liegenden Prozessen des Self-Referencing beschäftigten, zwei widersprüchliche Erklärungsansätze, wie sich die zusätzlich zur Verfügung stehenden kognitiven Ressourcen und die Bildung selbstbezogener Gedanken auf die Einstellung der Konsumenten auswirken.
Ein Ziel der Arbeit bestand daher darin, die in der bisherigen Self-Referencing-Literatur vorherrschende Meinung eines generell positiven Zusammenhangs zwischen dem Einsatz einer Self-Referencing-Technik und der Produktbewertung zu überprüfen. Zudem sollten in der Literatur vorzufindende Widersprüchlichkeiten in den unterstellten Prozessen aufgegriffen werden. So beruht die Arbeit auf der Überlegung, dass je nach eingesetztem Self- Referencing-Stimulus selbstbezogene Gedanken verschiedenen Inhalts ausgelöst werden, die sich auf unterschiedliche Weise auf die Produktbewertung auswirken. Das heißt, es wird unterstellt, dass sich je nach eingesetztem Stimulus die zugrunde liegenden Prozesse des Self- Referencing unterscheiden.
In der vorliegenden Arbeit wurden daher fünf Self-Referencing-Stimuli herausgegriffen (positive Self-Referencing-Instruktionen, negative Self-Referencing-Instruktionen, „Für dich“- Appelle, periphere Self-Referencing-Reize und Bildmotive von der Produktnutzung aus der Perspektive des Konsumenten, die die Gliedmaßen eines Produktnutzers zeigen). Der Effekt dieser Stimuli sollte in Abhängigkeit von der Tatsache, ob positiv-diagnostische Information oder nur neutral-diagnostische Information über das beworbene Produkt vorliegt, auf die Einstellung der Konsumenten untersucht werden. Hierfür wurden zunächst jeweils umfangreiche theoretische Überlegungen zu den jeweils ausgelösten Self-Referencing-Prozessen angestellt. Basierend auf diesen theoretischen Überlegungen wurde für jeden der untersuchten Self- Referencing-Stimuli ein Werbewirkungsmodell aufgestellt. Im Anschluss wurden die Werbewirkungsmodelle auf ihre Gültigkeit hin untersucht. Hierfür wurden zunächst in der bisherigen Literatur durchgeführte empirische Studien und deren Befunde näher betrachtet. Darüber hinaus wurden die Befunde eigener empirischer Experimente vorgestellt.
Zusammenfassend konnte die Gültigkeit der fünf Werbewirkungsmodelle mehrheitlich bestätigt werden. So resultierte im Fall neutral-diagnostischer Information ein positiver Effekt auf die Produktbewertung aus dem Einsatz positiver Self-Referencing-Instruktionen oder peripherer Self-Referencing-Reize, während ein negativer Effekt oder kein Effekt aus dem Einsatz der verbleibenden drei Stimuli resultierte. Im Fall positiv-diagnostischer Information konnte ein positiver Effekt auf die Produktbewertung gezeigt werden, wenn negative Self- Referencing-Instruktionen oder periphere Self-Referencing-Reize in das Werbemittel integriert wurden. Für die verbleibenden drei Stimuli resultierte ein negativer Effekt beziehungsweise kann der Effekt nicht eindeutig vorhergesagt werden. Damit widerlegen die Befunde die in der bisherigen Self-Referencing-Literatur vorherrschende Meinung eines generell positiven Zusammenhangs zwischen dem Einsatz einer Self-Referencing-Technik und der Produktbewertung. Vielmehr konnten die Befunde zeigen, dass der Effekt von Self-Referencing zum einen von dem verwendeten Stimulus und zum anderen von der Tatsache, wie erstrebenswert der Besitz eines Produkts erachtet wird, das heißt, ob positiv-diagnostische Information oder nur neutral-diagnostische Information über das beworbene Produkt vorliegt, abhängt.
Ein Ziel der Arbeit bestand daher darin, die in der bisherigen Self-Referencing-Literatur vorherrschende Meinung eines generell positiven Zusammenhangs zwischen dem Einsatz einer Self-Referencing-Technik und der Produktbewertung zu überprüfen. Zudem sollten in der Literatur vorzufindende Widersprüchlichkeiten in den unterstellten Prozessen aufgegriffen werden. So beruht die Arbeit auf der Überlegung, dass je nach eingesetztem Self- Referencing-Stimulus selbstbezogene Gedanken verschiedenen Inhalts ausgelöst werden, die sich auf unterschiedliche Weise auf die Produktbewertung auswirken. Das heißt, es wird unterstellt, dass sich je nach eingesetztem Stimulus die zugrunde liegenden Prozesse des Self- Referencing unterscheiden.
In der vorliegenden Arbeit wurden daher fünf Self-Referencing-Stimuli herausgegriffen (positive Self-Referencing-Instruktionen, negative Self-Referencing-Instruktionen, „Für dich“- Appelle, periphere Self-Referencing-Reize und Bildmotive von der Produktnutzung aus der Perspektive des Konsumenten, die die Gliedmaßen eines Produktnutzers zeigen). Der Effekt dieser Stimuli sollte in Abhängigkeit von der Tatsache, ob positiv-diagnostische Information oder nur neutral-diagnostische Information über das beworbene Produkt vorliegt, auf die Einstellung der Konsumenten untersucht werden. Hierfür wurden zunächst jeweils umfangreiche theoretische Überlegungen zu den jeweils ausgelösten Self-Referencing-Prozessen angestellt. Basierend auf diesen theoretischen Überlegungen wurde für jeden der untersuchten Self- Referencing-Stimuli ein Werbewirkungsmodell aufgestellt. Im Anschluss wurden die Werbewirkungsmodelle auf ihre Gültigkeit hin untersucht. Hierfür wurden zunächst in der bisherigen Literatur durchgeführte empirische Studien und deren Befunde näher betrachtet. Darüber hinaus wurden die Befunde eigener empirischer Experimente vorgestellt.
Zusammenfassend konnte die Gültigkeit der fünf Werbewirkungsmodelle mehrheitlich bestätigt werden. So resultierte im Fall neutral-diagnostischer Information ein positiver Effekt auf die Produktbewertung aus dem Einsatz positiver Self-Referencing-Instruktionen oder peripherer Self-Referencing-Reize, während ein negativer Effekt oder kein Effekt aus dem Einsatz der verbleibenden drei Stimuli resultierte. Im Fall positiv-diagnostischer Information konnte ein positiver Effekt auf die Produktbewertung gezeigt werden, wenn negative Self- Referencing-Instruktionen oder periphere Self-Referencing-Reize in das Werbemittel integriert wurden. Für die verbleibenden drei Stimuli resultierte ein negativer Effekt beziehungsweise kann der Effekt nicht eindeutig vorhergesagt werden. Damit widerlegen die Befunde die in der bisherigen Self-Referencing-Literatur vorherrschende Meinung eines generell positiven Zusammenhangs zwischen dem Einsatz einer Self-Referencing-Technik und der Produktbewertung. Vielmehr konnten die Befunde zeigen, dass der Effekt von Self-Referencing zum einen von dem verwendeten Stimulus und zum anderen von der Tatsache, wie erstrebenswert der Besitz eines Produkts erachtet wird, das heißt, ob positiv-diagnostische Information oder nur neutral-diagnostische Information über das beworbene Produkt vorliegt, abhängt.
Export of bibliographic data
Shaker Verlag GmbH
Am Langen Graben 15a
52353 Düren
Germany
Am Langen Graben 15a
52353 Düren
Germany
Mon. - Thurs. 8:00 a.m. to 4:00 p.m.
Fri. 8:00 a.m. to 3:00 p.m.
Fri. 8:00 a.m. to 3:00 p.m.
Contact us. We will be happy to help you.